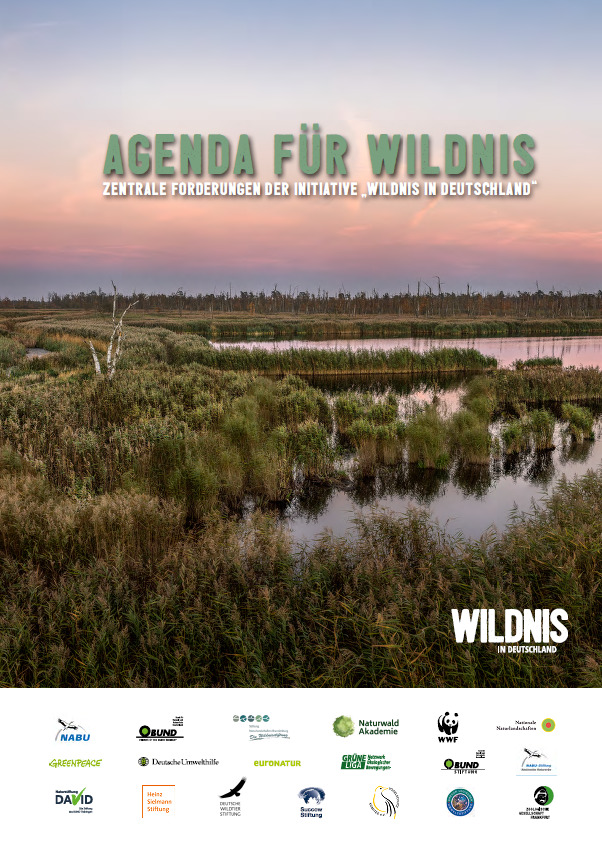Das Team im Bereich Schutzgebietsmanagement & Naturschutz bearbeitet Projekte, Programme und Anfragen zu allem, was mit Qualitätssicherung und -steigerung der Nationalen Naturlandschaften zusammenhängt. Wir stehen der Mitgliedschaft mit Rat und Tat zur Seite und geben Auskunft über naturschutzfachliche Themen und beantworten Fragen rund um das Management von Schutzgebieten. Dabei berücksichtigen wir die Expertisen der Mitgliedschaft und orientieren uns an deren Bedarfen. Den fachlichen Input, den wir gern aufgreifen und möglichst in zukünftige Projekte und Programme einfließen lassen, erhalten wir auch aus den Arbeitsgruppen des Dachverbands, zum einen aus den drei Struktur-AGs Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke und zum anderen aus den Fach-AGs Forschung & Monitoring sowie Schutzgebietsbetreuung. Wir übernehmen hier gern die Koordination des großen Netzwerks.
Dr. Neele Larondelle leitet den Bereich sowie die Koordinierungsstelle des Integrativen Monitorings und repräsentiert den Dachverband im Koordinierungsrat des biosphere.center, im Vorstand des Vereins für ökologische und ökosystemare Langzeitforschung LTER-Deutschland und im neuen Verein zur Digitalisierung der Regeln zur Nutzung der Natur Digitize the Planet. Außerdem ist sie für das Projekt BR-Connect und die Tagungsreihe „Biosphärenreservate International“ verantwortlich. Bei beidem wird sie von Stephanie Schubert unterstützt.
Anja May vertritt im Team die Themen Nationalparke und Wildnis. Sie leitet mit der Überarbeitung der Qualitätskriterien und -standards für deutsche Nationalparke ein Schlüsselprojekt zur Qualitätssicherung. Des Weiteren kümmert sie sich um Wildnisgebiete innerhalb der NNL-Familie und repräsentiert den Dachverband in der Initiative „Wildnis in Deutschland“. Zusätzlich ist sie aufgrund ihres beruflichen und sprachlichen osteuropäischen Kontextes sehr gern der Einladung des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation gefolgt und hat Ende November 2020 an einem digitalen „Kaminabend“ zum Thema Ökotourismus und Schutzgebietsreform in Russland teilgenommen. Die russische Seite war sehr interessiert an unseren Erfahrungen mit Naturerleben, Naturtourismus und naturverträglichem Reisen in den Nationalen Naturlandschaften. Für uns war es sehr spannend, in Richtung Osten zu schauen und mehr über die geplante Öffnung der russischen Schutzgebiete für den Ökotourismus zu erfahren– wobei wir diese Entwicklung auch mit einer gewissen Sorge sehen.
Anna Bach hat durch ihre Mitarbeit im Projekt „Integratives Monitoring der Großschutzgebiete“ eine hervorragende Übersicht über die vorhandenen Daten über die deutschen Nationalparke und Biosphärenreservate und ist damit unsere „Datenkrake“. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für das Thema Biosphärenreservate und leitet folgerichtig auch das Projekt „BROMMI – Biosphärenreservate als Modelllandschaften für den Insektenschutz“. Seit November 2020 wird sie von Sonja Miller während ihrer Elternzeit vertreten.