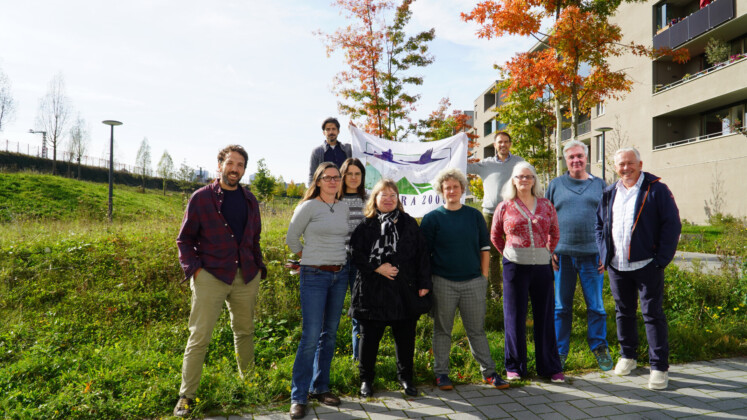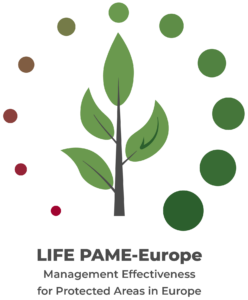Wir wollen Lebensräume wie Moore, Wälder, Auen und Küsten in ihrer Funktion als unsere wirksamsten natürlichen Klimaschützer stärken. In einer vom BfN mit Mitteln des BMUKN geförderten Potenzialanalyse identifizieren wir Beispiele guter Praxis und Potenziale für Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes, für den Wissenstransfer zwischen den Gebieten und für die spätere Umsetzung im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK). Darüber hinaus betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit, um das Thema natürlicher Klimaschutz (be-)greifbar zu machen.
Gemeinsam stärken wir unsere wirksamsten Klimaschützer
Über ein Drittel der Nationalen Naturlandschaften (NNL) – von den Küsten bis ins Hochgebirge – sind Modellgebiete für Natürlichen Klimaschutz. Im Rahmen von PANK haben wir rund 120 Projektideen aus den NNL aufgenommen und diese 2024, wo möglich, weiter vertieft. Es haben sich weitaus mehr Modellgebiete gemeldet als zu Projektbeginn angenommen, diese Entwicklung hat uns sehr gefreut! Weniger erfreulich ist die in Teilen schleppende Veröffentlichung der Förderrichtlinien des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK). Beiden Umständen können wir glücklicherweise mit einer Aufstockung des Projektes um ein Jahr bis März 2026 begegnen, die uns erlaubt, die Modellgebiete weiter bei der Entwicklung von Projektideen für die Beantragung im ANK zu begleiten.
Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag dazu, gemeinsam nachhaltige Lösungen, die ein dauerhaftes Speichern von Kohlenstoff, eine landschaftliche Anpassung an Klimaveränderungen sowie den Schutz und die Wiederherstellung biologischer Vielfalt ermöglichen, in Form von konkreten Maßnahmen in den Kontext der Nationalen Naturlandschaften zu übersetzen.
Sichtbarkeit für natürlichen Klimaschutz in den NNL
Wir haben 2024 genutzt, um unsere Materialien für die Öffentlichkeit auf der Woche der Umwelt zu testen und so eine breitere Öffentlichkeit für das Thema natürlicher Klimaschutz zu sensibilisieren und mehr Sichtbarkeit für die Arbeit der einzelnen Gebiete zu erzeugen. Ein herzliches Dankeschön für das Mitwirken vor Ort an Ursula und Frank Wendeberg und die Kolleg*innen von der Naturwacht Brandenburg und der KlimaWildnisZentrale sowie an die Stiftung Kunst und Natur für die Leihgabe des Moorkubus.
Um die 2023 gemeinsam mit der Wissenschaftsillustratorin Sophia Phildius erarbeiteten Illustrationen zum Thema Natürlicher Klimaschutz durch praktische Beschreibungen von Maßnahmen zu ergänzen, haben wir während der Vor-Ort-Termine kurze Videosequenzen aufgenommen, in denen verschiedene Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes von Kolleg*innen aus Modellgebieten erklärt werden.
Erfahrungsaustausch über Lebensräume hinweg
In einer Webinar-Reihe zum natürlichen Klimaschutz wurden von den Kolleg*innen aus den Gebieten Beispiele guter Praxis für Renaturierungen in Mooren, Auen, Wäldern, der Agrarlandschaft und zum Themenfeld Wildnis vorgestellt und anschließend diskutiert. Zu Gast waren auch Expert*innen aus der Wissenschaft wie etwa Dr. Franziska Tanneberger vom Greifswald Moor Centrum (GMC), die im Wissenschaftlichen Beirat des ANK tätig ist. Das Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz, das BMUKN, das BMEL und auch die KlimaWildnisZentrale waren mit Informationen zu den entsprechenden Förderrichtlinien des ANK dabei. Die Webinare stehen in der internen Wissensdatenbank zur Verfügung.
Fachliche und inhaltliche Konkretisierung der Projektskizzen
Die Vorstellung der Förderrichtlinien im Rahmen der Webinar-Reihe, aber auch im Rahmen der Online-Fragerunden zu den Handlungsfeldern des ANK, hatten zum Ziel, die Konkretisierung der Projektskizzen, wo möglich, zu unterstützen. Darüber hinaus nutzten wir auch die Termine vor Ort dazu, um Flächen zu besichtigen, Akteur*innen zu treffen und Detailfragen zu einzelnen Skizzen zu besprechen.
Wie geht es 2025 weiter?
Um die Konkretisierung der Projektideen weiter zu unterstützen, werden wir das Planungsbüro PAN beauftragen, im kommenden Jahr die Modellgebiete bei Bedarf fachlich zu beraten. Darüber hinaus wollen wir den Austausch mit dem Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz zur Beantwortung von förderrechtlichen Fragen verstärken. Wann immer es Neuigkeiten zu den Förderrichtlinien des ANK geben sollte, werden wir weiterhin Webinare und Fragerunden durchführen.
Neben der Konkretisierung der Projektskizzen werden wir 2025 die Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen, das heißt die Illustrationen zu selbsterklärenden Infografiken für den niedrigschwelligen Einsatz in den Gebieten ausbauen und an der Darstellung der Projektinhalte auf unserer Website arbeiten. Darüber hinaus werden wir bedarfsorientiert einzelne Bereisungen durchführen und eine Gesamtbilanz des Projektes vorbereiten.
Das ANK mag bisher nicht die bei Antragstellung für PANK erwartete Dynamik aufgenommen haben, wir bleiben mit unseren Beratungsangeboten aber gerade deshalb weiterhin aktiv, um bei Veröffentlichung weiterer Förderrichtlinien gut vorbereitet zu sein. Erste erfolgreiche Beispiele bestätigen diesen Weg. Danke an alle Kolleg*innen in den Gebieten, die sich im bisherigen Projektverlauf mit Projektideen, Beiträgen zu Beispielen guter Praxis für die Webinare, ihrer Präsenz bei der Woche der Umwelt, ihrer fachlichen Expertise bei den Terminen vor Ort, ihren Fragen während der offenen Fragerunden und in zahlreichen bilateralen Gesprächen eingebracht haben. Gemeinsam stärken wir unsere wirksamsten Klimaschützer.
Die Projektwebsite wird gemeinsam mit dem Relaunch der NNL Website voraussichtlich im Herbst 2025 veröffentlicht.